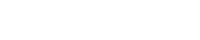Ich denke, also bin ich, sagt Descartes. Alles ist Kunst und jeder Mensch ist ein Künstler, sagt Joseph Beuys. Ich denke in Bildern, sagt Anselm Kiefer. Aber was ist Kunst? Das Wahre, Schöne, Gute? Im Lexikon wird sie erklärt als die gestaltende Tätigkeit des schöpferischen Menschengeistes in: – Architektur, Plastik – Malerei, Graphik, Kunsthandwerk – Musik, Dichtung, Theater und Tanz –. Das Kunstschaffen entspringt einem Urtrieb. Kinderzeichnungen geben uns davon einen unmittelbaren Eindruck.
Die allerersten Zeichnungen eines kleinen Kindes, seien sie mit Buntstift, Bleistift oder Wachsmalkreide, zeigen Striche, die in das Blatt auf der einen Seite hinein und auf der anderen Seite wieder hinaus kommen. Es geht meistens über den Bildrand hinaus – das Blatt reicht nicht aus. Viele Striche unter- und übereinander, meistens im oberen Drittel. So, als kämen sie an, möchten aber nicht bleiben. So wird es unzählige Male geprobt, bis irgendwann der Strich nicht mehr aus dem Blatt hinaus will. Es beginnt die Striche zu runden bis zum Urwirbel. Es übt unaufhörlich, bis eines Tages ein einzelner geschlossener Kreis auf dem Blatt erscheint, und irgendwann ein Punkt in der Mitte. Das Kind ist auf der Erde angekommen. Jetzt bekommt der Kreis ringsum Strahlen. Viele kleine Sonnen entstehen, kleine und große – Es ist die Zeit der Kopffüßler. Wer sagt den Kindern eigentlich, dass sie Kopffüßler malen sollen? Irgendwann werden die Striche länger und stellen Arme und Beine dar. Die Hände, wiederum kleine Sonnen – die Anzahl der Finger spielt keine Rolle. Langsam wird der Körper zu einer Leiter. Das Kind beginnt Vierecke zu zeichnen. Der Körper wird zum länglichen Kasten. Auf das Viereck folgt das Dreieck – ein Haus entsteht. Das Kind hat sich eine Hülle geschaffen – es ist in sein Haus eingezogen.
Das faszinierende an diesen Kinderzeichnungen ist, dass alle Kinder, gleich welchem Kultukreis rund um den Globus sie angehören – schwarz, rot, gelb oder weiß – in ihrer frühkindlichen Entwicklung alle die gleichen Bilder zeichnen. Es gibt im Leben keine Zufälle. Als ich am Samstagmorgen unseren Briefkasten öffnete, kam mir die Post vom SOS-Kinderdorf mit einem Kalender entgegen. Zunächst wollte ich ihn zur Seite legen, blätterte aber kurzerhand einmal durch. Meine Freude war übergroß, als ich die Zeichnung eines vierjährigen Jungen aus Simbabwe entdeckte. Es war genau so ein Mensch dargestellt, wie ich ihn kurz zuvor beschrieben habe. Nach einer chassidischen Legende, gesammelt von Martin Buber, brennt jedem Kind im Mutterleib ein Licht auf dem Kopf und es lernt die ganze Thora. Wenn ihm aber bestimmt ist, hinaus in die Luft der Welt zu gehen, kommt ein Engel und schlägt ihm auf den Mund – und da vergisst es alles. Vor unserer Geburt haben wir alles gewusst. Durch den Nasenstüber des Engels kommt jedes Kind wie eine scheinbar leere Hülle auf die Welt, die sich nun neu füllen kann.
Es liegt im Wesen der Kunst, Trägerin einer Mitteilung zu sein. Schon Platon dachte über die Kunst nach: »Wenn es etwas gibt, wofür zu leben lohnt, dann ist es die Betrachtung des Schönen.« Sein Schüler Aristoteles konnte das so nicht stehen lassen. Für ihn existieren die Ideen, d.h. die Formen der Wirklichkeit allein in der Wirklichkeit. Alles was ist, ist eine Einheit von Stoff und Form. Für Aristoteles bemisst sich der Wert eines Kunstwerkes nicht alleine an seinem inneren Wahrheitsgehalt, sondern auch an seiner Wirkung auf den Betrachter. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Oft stehe ich vor einem Kunstwerk und frage mich, was den Künstler dazu wohl bewogen hat. Bei Immanuel Kant wiederum lässt sich die Schönheit weder an irgendwelchen Bestimmungen des Gegenstandes fest machen und begrifflich fassen, noch konnte etwas schon deshalb schön gelten, weil es irgendjemanden oder auch allen Lust bereitet. Eine Mahlzeit kann z.B. zugleich angenehm und schlecht sein, indem sie uns schmeckt aber unserer Gesundheit schadet. So lässt sich niemand durch aufzählen der Zutaten, seien sie auch noch so gesundheitsfördernd, davon überzeugen, dass ihm das daraus zusammengesetzte Gericht zu schmecken habe. Dasselbe gilt für die Beurteilung eines Gegenstandes. Selbst wenn die Fertigung den allgemeinen Regeln entspricht und sie aufs genaueste befolgt wurden, werde ich mich doch hierdurch nicht überreden lassen, den Gegenstand schön zu finden.
Dazu eine kleine Episode über Leonardo da Vinci: Der Meister ersann eine Skala von Löffelchen, mit welchen verschiedene Farben zu nehmen waren. Es sollte dadurch ein mechanisches Harmonisieren erreicht werden. Einer seiner Schüler quälte sich mit der Anwendung dieses Hilfsmittels, und durch Misserfolg verzweifelt, wendete er sich an seinen Kollegen mit der Frage, wie der Meister selbst mit den Löffelchen umgehe. »Der Meister wendet sie nie an«, antwortete ihm der Kollege. Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) definiert in seiner Niederschrift »Die Welt als Wille und Vorstellung«, die »Kunst als Betrachtungsart der Dinge, unabhängig vom Satze des Grundes.« »Niemand darf dem Künstler vorschreiben, dass er edel und erhaben, moralisch, fromm, christlich, oder Dies oder Das sein soll, noch weniger ihm vorwerfen, dass er Dies oder Jenes sei. Er ist der Spiegel der Menschheit und bringt ihr was sie fühlt und treibt zum Bewusstsein.« »Während dem gewöhnlichen Menschen sein Erkenntnisvermögen die Laterne ist, die seinen Weg beleuchtet, ist es den Genialen die Sonne, welche die Welt offenbar macht.« Soweit Schopenhauer.
Malewitsch möchte mit der Farbe die Feierlichkeit des Weltalls spürbar machen. Er sieht den Sinn der Malerei in der Bewegung auf das Unendliche zu, auf die Zone jener »gegenstandslosen« Vollkommenheit, in der der Gegensatz zwischen Mensch und Natur, Geist und Materie aufgehoben wäre. Dafür stehen wohl das weiße und das schwarze Quadrat. Zwischen diesen beiden Polen – ganz hell und ganz dunkel – spielt sich das Leben der gesamten Farbskala ab. Wie könnte ich den Klang des Tages in einem Stein ausdrücken, oder auch nur den eines Augenblickes? Im Volksmund heißt es: »Kunst kommt von Können – käme es von Wollen, hieße es Wunst«. Dadaistisch weitergedacht: kommt die Kunst vom Denken, hieße es Dunst. Der Journalist, Dietmar Pieper, Autor eines Artikels »Was ist Kunst« in Spiegel Spezial vom Dezember 1996, dachte ebenfalls über die Kunst nach und kam zu folgendem Ergebnis: »Kunst kommt von Kaufen. Ja, das Geld machts – weder der Schweiß, noch die Inspiration, weder das Augenmaß, noch die Mundfertigkeit, weder der feine Pinselstrich, noch die harte Linienführung. Das alles ist schön, wichtig, ist gut. Aber es reicht nicht aus. Nur das Geld lässt toten Stoff schweben, beseelt Fett und Filz und Öl, verwandelt Marmor in Kunst.« Duchamps berühmtes Urinal war nicht deshalb Kunst, weil Duchamps es behauptete und weil die Kritik ihm zustimmte. Es war Kunst, weil es Leute gab, die auf Duchamps gesetzt hatten – ähnlich wie bei einer Wette – und die bereit waren, ihre Hoffnung nicht nur in Worten, sondern in Geld auszudrücken. Die Käufer haben auf den Kunstcharakter der Urinale, Flaschenhalter und Fahrrad-Räder Duchamps spekuliert – und gewonnen.
Am Hungertuch zu nagen,
Ist des Künstlers schönstes Los.
Im Gegenteil, so prunkvoll,
Wie ein Papst sein,
Macht ihn groß.
Das alles sei Hose wie Jacke.
Ob Schulden, ob Geld auf der Bank!
Hauptsache, er hat ‘ne Macke
Und nicht alle Tassen im Schrank.
Danke, dass Sie mir zugehört haben!